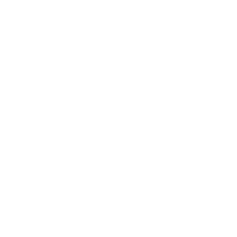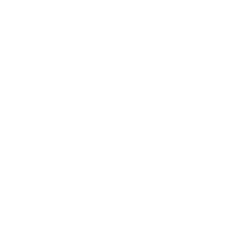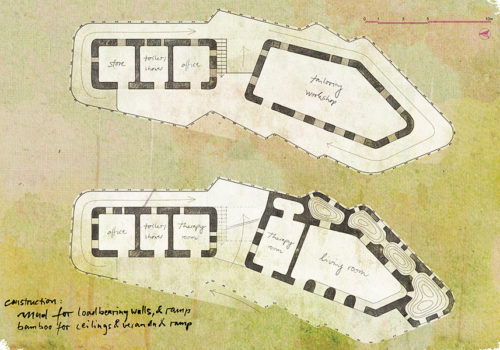Preisträger 2020
Die Preisträger kommen in diesem Jahr aus Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Slowenien, Spanien und den USA.
Die Sonderausgabe des AIT-Dialog zum AIT-Award 2020 mit der Präsentation aller Preisträger können Sie hier als PDF herunterladen: > zum Download
1. Preis
Fabra & Coats Industrial Heritage + Social Housing, ES-Barcelona | Roldán + Berengué, ES-Barcelona
Mit viel Ideenreichtum transformierte das Architekturbüro Roldán + Berengué das 1905 erbaute ehemalige Lagerhaus in ein Wohnprojekt. Auf dem ehemaligen Industrieareal entstanden 41 für junge Menschen konzipierte Sozialwohnungen sowie fünf Künstlerateliers.
Bauherr: Barcelona City Council
Ort: ES-Barcelona
Architekten: Roldán & Berengué
roldanberengue.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Jordi Surroca
2. Preis
Bezahlbarer Wohnraum für alle der I+B Baechi Stiftung, CH-Zürich | gus wüstemann architects, CH-Zürich
Gus wüstemann architects beweisen, dass mit gezielten Interventionen in Licht und Raum, bei gleichzeitiger Reduktion der Standards, großzügige Wohnräume möglich sind.
Bauherr: I+B Baechi Stiftung
Ort: CH-Zürich
Architekten: gus wüstemann architekten, CH-Zürich
guswustemann.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Bruno Helbling
3. Preis
Wohnatelierhaus “Altes Weinlager”, CH-Nuglar | lilitt bollinger studio, CH-Nuglar
Das alte Weinlager der Schnapsbrennerei Urs Saladin AG von 1956 war früher ein reines Lagerhaus. Mit seinem markanten Volumen ist es ein Teil der städtebaulichen und kulturellen Geschichte der Gemeinde Nuglar. Durch eine Umzonung in W2 war das bestehende Gebäudevolumen aufgrund der neuen Ausnützungsziffer zu groß, sodass das Gebäude zum Abriss freigegeben wurde.
Bauherr: Hürzeler Holzbau AG
Ort: CH-Nuglar
Architekten: lilit bollinger studio, CH-Nuglar
lilittbollinger.ch
Fertigstellung: 2019
Fotos: lilitt bollinger studio
Auszeichnung
Wohnsiedlung Toblerstrasse, CH-Zürich | BS+EMI Architektenpartner, CH-Zürich
Das Züricher Quartier Fluntern ist durch eine homogene städtebauliche Struktur geprägt. Repräsentative, straßenseitige Eingänge prägen das Bild. Hier haben BS+EMI Architektenpartner 13 kompakte Solitärbauten mit eindeutiger Straßenfassade realisiert, die trotz einer deutlich höheren Bebauungsdichte typologisch an den Bestand anknüpfen.
Bauherr: Allgemeine Baugenossenschaft Zürich
Ort: CH-Zürich
Architekten: BS+EMI Architektenpartner, CH-Zürich
bs-emi.ch
Fertigstellung: 2018
Fotos: Roland Bernath
Auszeichnung
Espai Natura, ES-Sant Cugat del Valles Catalonia | BAILORULL ADD+ Arquitectura, ES-Barcelona
Gemeinsam mit dem Projektentwickler Marcrove haben Bailorull den neuen architektonischen Standard H.A.U.S entwickelt – für eine verantwortliche und zugleich kreative architektonische Praxis, die gesundheitliche Aspekte in den Wohnungsbau einfließen lässt.
Bauherr: Marcove – H.A.U.S.
Ort: ES-Sant Cugat del Vallès
Architekten: BAILORULL ADD+ Architectura, ES-Barcelona
www.addarquitectura.net
Fertigstellung: 2018
Fotos: José Hevia
Auszeichnung
House of Roofs, TW-Pingtung | behet bondzio lin architekten, DE-Münster
behet bondzio lin architekten aus Münster haben in der taiwanesischen Stadt Pingtung ein Gebäude für zwei Mehrgenerationenfamilien entwickelt. Die Wohneinheiten verteilen sich auf lang gestreckte lineare Volumen mit 16 gestapelten und verschobenen Dächern und Terrassen.
Bauherr: Mr Chen, Mr. Hsieh
Ort: TW-Pingtung City
Architekten: behet bondzio lin architekten, DE-Münster
www.2bxl.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Chao Yu-Chen
1. Preis
Casa do Rio, PT-Quinta do Orgal | Menos é Mais Arquitectos, PT-Porto
Im Dourotal, inmitten einer beeindruckenden, unter dem Schutz der UNESCO stehenden Landschaft entwickelten Menos é Mais Arquitectos dieses kleine Hotel für einen Weinbaubetrieb. Im Sinne des Agrotourismis respektiert es vorbildlich die einzigartige Umgebung im Norden Portugals.
Bauherr: Quinta do Vallado, Sociedade Agricola, Lda
Ort: PT-Quinta do Orgal
Architekten: Menos é Mais Arquitectos
menosemais.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: José Campos, Francisco Vieira de Campos
2. Preis
Hotel Bauhofstrasse, DE-Ludwigsburg | VON M, DE-Stuttgart
Der Neubau des „Hotels Bauhofstraße“ an der Stadtterrasse soll mehr als nur ein Hotel sein. Durch seine exponierte Lage in einem seit Jahren städtebaulich vernachlässigten Gebiet setzt das Gebäude insbesondere Akzente in architektonischer, bautechnischer und ökologischer Sicht und leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zur Revitalisierung und Aufwertung des Umfeldes.
Bauherr: Fedor Schoen GmbH & Co.KG
Ort: DE-Ludwigsburg
Architekten: von M, DE-Stuttgart
vonm.de
Fertigstellung: 2019
Fotos: Brigida González
3. Preis
Casa Rosa Hotel, PT-Porto | Nuno Graça Moura, Arquitecto, PT-Porto
Das 1949 erbaute Casa Rosa Hotel im Stadtzentrum von Porto wurde vom Architekten Nuno Graça Moura saniert und neu interpretiert. Die neue Verkleidung gibt dem Haus ein neues äußeres Erscheinungsbild.
Bauherr: Incredible Place, Unipessoal Lda.
Ort: PT-Porto
Architekten: Nuno Graça Moura
nunogracamoura.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Carlos Castro
Auszeichnung
Gerling Quartier, 25hours Hotel, DE-Köln | O&O Baukunst, DE-Köln, Studio Aisslinger, DE-Berlin
Geometrische Grundformen sowie ein homogener Naturstein mit kräftiger, vertikaler Lisenenstruktur prägen Fassaden und Erscheinungsbild des gesamten Gerling-Komplexes im Kölner Friesenviertel.
Bauherr: ImmofinanzFriesenquartier GmbH
Ort: DE-Köln
Architekten:O & O Baukunst, DE-Köln
ortner-ortner.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Mario Brand, Marcus Schwier
Auszeichnung
Lamaison Gästehaus, DE-Saarlouis | CBAG Beaumont I Gergen Architekten, DE-Saarlouis
Das neue Gästehaus vergrößert das Designhotel von LAMAISON um zehn Zimmer, zwei Suiten und einen Seminarbereich. Die Erweiterung liegt mitten im Park, sodass Natur und Gebäude eng miteinander verbunden sind. CBAG.Studio verfolgt einen sehr reduzierten Ansatz.
Bauherr: Hotel Lamaison / Günter Wagner
Ort: DE-Saarlouis
Architekten: CBAG.Studio, Saarlouis
cbag.studio
Fertigstellung: 2019
Fotos: Brigida González
Auszeichnung
Schloss Prossen, DE-Bad Schandau | schoper.schoper Architekten, DE-Dresden
Das Schloss Prossen in der Sächsischen Schweiz ist ein Landsitz, der in seiner langen Geschichte seit dem 16. Jahrhundert höchst unterschiedlich genuzt wurde: Herrensitz mit eigener Gerichtsbarkeit, Familiensitz, Ideenschmiede einer Maschinenfabrik, Grundschule, Kindergarten.
Bauherr: Rittergut Prossen GbR
Ort: DE-Bad Schandau
Architekten: schoper.schoper, DE-Dresden
schoperschoper.de
Fertigstellung: 2019
Fotos: Photography Till Schuster
1. Preis
Decantei – Das Wirtshaus, IT-Brixen | PEDEVILLA ARCHITECTS, IT-Bruneck
Tradition
Die baulichen Anfänge Wirtshauses in der Brixner Altstadt reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Mehrere aufeinanderfolgende historische Innenräume bieten Platz für bis zu hundert Personen, ein Innenhof und sonniger Garten ergänzen den Gastbetrieb.
Bauherr: DieDechantei GmbH
Ort: IT-Brixen
Architekten: Pedevilla Architects, IT-Bruneck
pedevilla.info
Fertigstellung: 2019
Fotos: Gustav Willeit
2. Preis
Mensa Neubau Hochschule Luzern – Campus Zug, CH-Rotkreuz | Büro Konstrukt Architekten / Manetsch Meyer Architekten, CH-Luzern/Zürich
Der Mensa-Neubau für die Hochschule Luzern in Rotkreuz komplettiert das Angebot des Hochschulcampus. Die Architekten entschieden sich für eine Holzhybrid-Bauweise und betonten das Material durch die dunklen Akustiksegel.
Bauherr: Zug Estates AG / Hochschule Luzern
Ort: CH-Rotkreuz
Architekten: Büro Konstrukt & Manetsch Meyer (ARGE)
buerokonstrukt.ch
manetschmeyer.ch
Fertigstellung: 2019
Fotos: Kuster Frey Fotografie
3. Preis
Spooning Cookie Dough Bar, DE-Berlin | Zentralnorden Kreativgesellschaft, DE-Berlin
Keksteig macht glücklich, aber nicht gesund. Er fällt durch alle Flexi-Lowcarb-Paleo-Lifestyles heutiger Ernährungsgurus. Egal! Keksteig ist eine Hommage an fröhliche Kindheitserinnerungen und eine Liebesbekundung an ein unbeschwertes, leichtes Leben ohne Meetings, Effizienz und Rendite. Diese Leichtigkeit findet sich in jeder Teigflocke des Corporate Designs für Spooning wieder.
Bauherr: Spooning Cookie Dough
Ort: DE-Berlin
Architekten: Zentralnorden, DE-Berlin
zentralnorden.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Zentralnorden
Auszeichnung
Johann | Hotel und Gasthaus am Alten Markt, AT-Lauterach | Ludescher + Lutz Architekten, AT-Bregenz
Mit dem einprägsamen Neubau leiten Ludescher + Lutz Architekten in Lauterach eine Wiederbelebung des Ortszentrums ein. Der Holzbau soll dem Alten Markt und damit dem historischen Kern der Rheintalgemeinde ein neues Gesicht verleihen und bezieht sich in seiner Volumetrie auf historische Bauten der Altstadt.
Bauherr: i+R Gruppe
Ort: AT-Lauterach
Architekten: Ludescher + Lutz Architekten, AT-Bregenz
ludescherlutz.at
Fertigstellung: 2018
Fotos: Ulla Wälder
Auszeichnung
SANPOU Nishimuraya, JP-Kinosaki Toyooka Hyogo | Ryo Matsui Architects, JP-Tokyo
Kinosaki Onsen, einer der traditionellen Kurorte Japans, ist um sieben heiße Quellen angelegt. Der Wohlstand der Stadt basiert auf dem Tourismus und der Kultur der Gastfreundschaft. In dem Maße, in dem die Besucher zunahmen, wurden neue Funktionen nötig: „Erfrischungsstationen“ etwa als Ruhestätten auf den Weg zu den sieben Quellen oder ein Restaurant, das die lokale kulinarische Kultur pflegt.
Bauherr: Nishimuraya
Ort: JPN-Kinosaki
Architekten: Ryo Matsui Architects, Jpn-Tokio
matsui-architects.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Ryo Matsui Architects
Auszeichnung
Reloaded – Traditionscafé, DE-Neuburg an der Donau | Reimann Architecture, DE-Hamburg
Einem Traditionscafé mit angeschlossener Bäckerei und Konditorei im oberbayerischen Neuburg an der Donau hat das Hamburger Büro Reimann architecture neues Leben eingehaucht – inspiriert vom Mid-Century Stil, der Funktionalität und klare Formen in den Mittelpunkt stellt.
Bauherr: Göbel – Bäckerei & Kaffeehaus
Ort: DE-Neuburg an der Donau
Architekten: Reimann architecture, DE-Hamburg
reimann-architecture.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Reimann architecture
1. Preis
Stand POD, BR-São Paulo | Forte, Gimenes e Marcondes Ferraz Arquitetos, BR-São Paulo
Für diesen Pop-up-Showroom, der auf ein hier entstehendes Gebäude hinweist, gingen FGMG einen ungewöhnlichen Weg. Sie erstellten eine Gerüstkonstruktion, die sich auf das von ihnen geplante Gebäude bezieht und zugleich einen urbanen Platz in São Paulo neu belebt.
Bauherr: Nortis
Ort: BR-São Paulo
Architekten: FGMF
www.fgmf.com.br
Fertigstellung: 2018
Fotos: FGMF
2. Preis
Le Cube, FR-Paris | MANA DESIGN AND SCALAPLUS, US-Chicago, IL
Le Cube wurde als Herzstück der Schau „Los Angeles Rive Gauche“ in Paris enthüllt – einer Ausstellung mit einer Sammlung von LA-Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Produkten im Kaufhaus Le Bon Marche. Der in diesem Zusammenhang angesiedelte Le Cube fungierte sowohl als Bühne als auch als Skulptur.
Bauherr: Le Bon Marche and Scott Oster
Ort: F-Paris
Architekten: Mana Design/ Scalaplus, US-Chicago
www.manaves.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: John Manaves
3. Preis
Zalando Beauty Station, DE-Berlin | BATEK ARCHITEKTEN, DE-Berlin
Zurückhaltend, aber mit einem stringenten Look, der viele spannende Kulissen bietet, mit denen als Hintergrund sich auch ein Selfie auf Instagram sehen lassen kann, entwarfen Batek Architekten diesen Beauty Store, der flexibel und anpassbar Raum schafft für Warenpräsentation, Pop-Up Events, Veranstaltungen, Beautyservices und Videodrehs.
Bauherr: Zalando SE
Ort: DE-Berlin
Architekten: Batek Architekten, DE-Berlin
batekarchitekten.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Markus Wend
Auszeichnung
MPREIS, AT-Weer | LAAC, AT-Innsbruck
Das Innsbrucker Architekturbüro LAAC hat für das Unternehmen MPREIS im österreichischen Weer einen neuen Markt entworfen, der Engagement für Nachhaltigkeit und das Bewusstsein für lokale Belange unterstreichen sollen. Der Lebensmittelmarkt ist in die umgebende Landschaft eingebunden, um die Herkunft und die Qualität der Produkte in den Mittelpunkt zu stellen.
Bauherr: MPREIS Warenvertriebs GmbH
Ort: AT-Weer
Architekten: LAAC, AT-Innsbruck
laac.eu
Fertigstellung: 2017
Fotos: Marc Lins
Auszeichnung
Schubert Apotheke, DE-Pullach | raumkontor Innenarchitektur, DE-Düsseldorf
Bei der Modernisierung der Schubert Apotheke im bayrischen Pullach legte raumkontor aus Düsseldorf sein Hauptaugenmerk auf die formale Gestaltung und die Auswahl der Materialien. Die gestreiften und gebürsteten Holzstrukturen der Eiche sowie der im nahen Umland abgebaute Kalkstein vermitteln Wärme.
Bauherr: Frau Dr. Katalin Bosedt, Herr Axel Schwarz
Ort: DE-Pullach
Architekten: raumkontor Innenarchitektur, Düsseldorf
raumkontor.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Hans Jürgen Landes
Auszeichnung
Frankfurt Pavilion, DE-Frankfurt am Main | schneider+schumacher, DE-Frankfurt am Main
Der Entwurf sieht eine temporäre solide Konstruktion vor, die unkompliziert zwischengelagert und wieder aufgebaut werden kann, um eine nachhaltige Nutzung innerhalb des Messegeschehens über die nächsten Jahre hinweg zu garantieren.
Bauherr: Frankfurter Buchmesse GmbH
Ort: DE-Frankfurt am Main
Architekten: schneider+schumacher, Frankfurt am Main
schneider-schumacher.de
Fertigstellung: 2018
Fotos: Kirsten Bucher
1. Preis
Stenhöga, SE-Stockholm | Tham & Videgård Arkitekter, SE-Stockholm
Die neuen Bürogebäude in Stockholmer Stadtteil Huvudsta wurden um die Idee herum entwickelt, dass jene Gebäude die nachhaltigsten sind, die am längsten in Betrieb bleiben. Robustheit erschien den Architekten von Tham & Videgård dabei als entscheidender Faktor – solide und verlässliche Konstruktionsmethoden sollten eine nachhaltige Bauweise garantieren.
Bauherr: Humlegården Fastigether AB
Ort: SWE-Stockholm
Architekten: Tham & Videgård Arkitekter, SWE-Stockholm
thamvidegard.se
Fertigstellung: 2019
Fotos: Tham & Videgård
2. Preis
Alpin Sport Zentrum, AT-Schruns | Bernardo Bader Architekt, AT-Bregenz
Beim Entwurf für das neue Alpin Sport Zentrum leitete bernardo bader architekten der städtebauliche Leitgedanke einer solitären Baukörpersetzung, die im Zusammenspiel mit der umgebenden Bebauung in einer kleinen Gemeinde in Vorarlberg einen neuen, gefassten Platzraum schafft.
Bauherr: Silvretta Montafon GmbH
Ort: AT-Schruns
Architekten: bernardo bader architekten, AT-Bregenz
bernardobader.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Adolf Bereuter, Dornbirn
3. Preis
Olympic House, CH-Lausanne | 3XN Copenhagen, DK-Copenhagen KItten+Brechbühl, CH-Basel RBSGROUP, DE-München
Das neue Hauptquartier des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne, Schweiz kombiniert höchste Standards in der architektonischen Gestaltung mit einem ganzheitlichen Ansatz von Nachhaltigkeit. Für die Architekten von 3XN steht das neue Gebäude für Bewegung, Transparenz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit und soll insgesamt die Grundwerte der Olympischen Bewegung vermitteln.
Bauherr: The International Olympic Committee
Ort: CH-Lausanne
Architekten: 3XN, DK-Kopenhagen
3xn.com
IttenBrechbühl, CH-Basel
ittenbrechbuehl.ch
Fertigstellung: 2019
Fotos: 3XN / IttenBrechbühl / Adam Mørk
Auszeichnung
Porten-/Servicegebäude und Auditorium, CH-Kaiseraugst | Nissen Wentzlaff Architekten, CH-Basel
Mit dem „Masterplan Kaiseraugst Ost“ von Nissen Wentzlaff Architekten erweiterten Nissen Wentzlaff Architekten das bestehendeHoffmann-La Roche Forschungs- und Produktionsareal am Standort Kaiseraugst Richtung Osten und verdoppelten es in seiner Grundfläche.
Bauherr: F. Hoffmann-La Roche AG
Ort: CH-Kaiseraugst
Architekten: Nissen Wentzlaff Architekten BSA SIA AG, CH-Basel
nwarch.ch
Fertigstellung: 2017
Fotos: Nissen Wentzlaff Architekten
Auszeichnung
Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade, DE-Rutesheim | a+r Architekten, DE-Stuttgart
Das Raumprogramm des Neubaus für das Deutsche Stuckateurhandwerk beinhaltet Büro-, Schulungs- und Veranstaltungsräume, Übernachtungszimmer, einen Mensabereich sowie eine Hausmeisterwohnung. Das Zentrum soll das wesentliche Leistungsspektrum der Stuckateure thematisieren.
Bauherr: Berufförderungsgesellschaft des Stuckateurhandwerks GmbH
Ort: DE-Rutesheim
Architekten: a+r Architekten, Stuttgart
www.ackermann-raff.de
Fertigstellung: 2019
Fotos: Brigida González
Auszeichnung
Final Outcome, IT-Arzignano | AMAA Collaborative Architecture Office For Research and Development, IT-Venice
In Arzignano, in der Provinz Vicenza in Venetien, fand das italienische Architekturbüro AMAA Collaborative Architecture Office for Research and Development in einem ehemaligen Fabrikgebäude eine neue Heimat.
Bauherr: Alias srl – Marco Mettifogo
Ort: IT-Arzignano
Architekten: AMAA Collaborative Architecture Office for Research and Development, IT-Venezia/Arzignano
www.amaa.studio
Fertigstellung: 2019
Fotos:: amaa studio
Auszeichnung
Büro der IBA Thüringen im Eiermannbau, DE-Apolda | IBA Thüringen, DE-Apolda
Das als Weberei Anfang des 20. Jahrhunderts realisierte Fabrikgebäude wurde 1938/39 von Egon Eiermann respektvoll umgebaut und im Stil des neuen Bauens als Feuerlöschgerätewerk erweitert. .
Bauherr: IBA Thüringen
Ort: DE- Apolda
Architekten: IBA Thüringen, DE-Apolda
Fertigstellung: 2018
Fotos: Thomas Müller, Henry Sowinski
Auszeichnung
Neue Arbeitswelt 205, DE-Schwäbisch Gmünd | Studio Alexander Fehre, DE-Stuttgart
Die neue Arbeitswelt, die Alexander Fehre in Schwäbisch Gmünd für den Automobilzulieferer Robert Bosch entwarf, basiert voll und ganz auf dem Credo der „agilen Arbeitsweise“: Ideen sollen nicht mehr nur von einzelnen Personen entwickelt werden, sondern in einem lebendigen Wissenskollektiv entstehen.
Bauherr: Robert Bosch Automotive Steering GmbH
Ort: DE-Schwäbisch Gmünd
Architekten: Studio Alexander Fehre, DE-Stuttgart
www.alexanderfehre.de
Fertigstellung: 2017
Fotos: Zooey Braun
1. Preis
Magyizin Hospital, MM-Magyizin | a+r Architekten, DE-Stuttgart
Abgelegen an der Südwestküste Myanmars liegt das Urwald-Dorf Magyizin mit seinen vielen kleinen Nachbarorten. Dörfer, wie sie ursprünglicher nicht sein könnten: Bambushütten im Sand unter Palmen ohne Strom und Wasser, keine befestigte Straße, die in die Region führt, die nächstgelegene medizinische Versorgung mehrere Stunden entfernt. a+r Architekten aus Stuttgart verbessern mit dem Neubau des Hospitals die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung.
Bauherr: Projekt Burma e. V.
Ort: Myanmar-Magyizin
Architekten: a+r Architekten, DE-Stuttgart
ackermann-raff.de
Fertigstellung: 2019
Fotos: Oliver Gerhartz
2. Preis
Kálida Sant Pau Centre, ES-Barcelona | MIRALLES TAGLIABUE EMBT, ES-Barcelona,Patricia Urquiola, IT-Milan
Für das skulpturale Kálida Sant Pau Centre – das erste Maggie‘s Centre auf dem europäischen Festland – zeichnet Benedetta Tagliabue verantwortlich. Mit seiner einprägsamen Formensprache fügt es sich harmonisch zwischen einer Krebsstation aus dem Jahr 2009 und dem modernistischen Hospital de Sant Pau ein, das von 1902 bis 1930 erbaut wurde.
Bauherr: Fundació Kálida, Nous Cims, Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Maggie’s Centres
Ort: ES-Barcelona
Architekten: Miralles Tagliabue, Barcelona
mirallestagliabue.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Duccio Malagamba
3. Preis
High Resolution Hospital Center, ES-Cazorla | EDDEA Arquitectura y Urbanismo, ES-Sevilla
Für die Architekten ähnelt die durch sanfte Hügel gekennzeichnete Landschaft der andalusischen Provinz Jaén einem natürlichen „Amphitheater“, das vom Fluss Guadalquivir und seinen Nebenflüssen durchquert wird. Daher sollte diese besondere Umgebung bei der Konzeption des neuen Krankenhauses eine entscheidende Rolle spielen.
Bauherr: Office for public health of Andalusia
Ort: ES-Cazorla (Jaén)
Architekten: EDDEA Arquitectura y Urbanismo
www.eddea.es
Fertigstellung: 2018
Fotos: Fernando Alda
Auszeichnung
Senior*innenwohnhaus Nonntal, AT-Salzburg | ATELIER GASPARIN MEIER ARCHITEKTEN, AT-Villach
Mitten in einer ausgedehnten Parklandschaft mit Blickkontakt zur Hohensalzburg realisierte das Architekturbüro Gasparin Meier in Nachbarschaft zu einem denkmalgeschütztem „Versorgungsheim“ ein neues Wohnkonzept für Seniorinnen und Senioren.
Bauherr: Stadt Salzburg
Ort: AT-Salzburg
Architekten: Atelier Gasparin Meier Architekten, AT-Villach
Fertigstellung: 2019
Fotos: Paul Ott
Auszeichnung
Gesundheitseinrichtung Josefhof, AT-Graz | Dietger Wissounig Architekten, AT-Graz
Die Gesundheitseinrichtung Josefhof des Büros Dietger Wissounig Architekten liegt am ruhigen, idyllischen Stadtrand von Graz und bietet als Kompetenzzentrum für stationäre Gesundheitsförderung und Prävention ein abwechslungsreiches Angebot an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für eine Versicherungsanstalt.
Bauherr: Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau
Ort: AT- Graz
Architekten:Dietger Wissounig Architekten, AT-Graz
wissounig.at
Fertigstellung: 2014
Fotos: Paul Ott, Graz
Auszeichnung
Pflegeheim St. Peter & Paul, LI-Mauren | atelier ww Architekten, CH-Zürich
Das Pflegeheim ist ein Ort, an dem man zu Hause ist und angemessen und würdevoll lebt. Dem Zürcher Architekturbüro atelier ww Architekten ist es mit dem Pflegeheim St. Peter & Paul in Mauren gelungen durch eine offene Gebäudestruktur und lichtdurchflutete Räumlichkeiten ein Ort der Begegnung mit hohem Wohlfühlcharakter zu erschaffen.
Bauherr: LAK | Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe
Ort: LI-Mauren
Architekten: atelier ww Architekten SIA AG, CH-Zürich
atelier-ww.ch
Fertigstellung: 2018
Fotos: atelier ww, Paul-Trummer
1. Preis
Meditationshaus im Wald, DE-Krün | Studio Lois Architektur und Ideenentwicklung, AT-Innsbruck, Kengo Kuma and Associates, JP-Tokyo
Mit dem Meditationshaus im oberbayrischen Krün haben Studio Lois Architektur gemeinsam mit dem japanischen Architekturbüro Kengo Kuma auf behutsame Art und Weise eine Ruheoase geschaffen. Mit seiner vergleichsweise kleinen Grundfläche wirkt der Solitär fast wie auf die Waldlichtung gezaubert.
Bauherr: Hotel Kranzbach GmbH
Ort: DE- Krün
Architekten: Studio lois Architektur, AT-Innsbruck mit Kengo Kuma AA, JP-Tokyo
studiolois.io
Fertigstellung: 2018
Fotos: David Schreyer
2. Preis
Ice Stadium – Schierker Feuerstein Arena, DE-Wernigerode | GRAFT, DE-Berlin
Das denkmalgeschützte Natureisstadion in Schierke, ein Ortsteil der Stadt Wernigerode am Fuße des Brockens im Harz, erfuhr einen Umbau. 2013 konnte GRAFT die europaweite Ausschreibung für die Reaktivierung des ehemaligen Eisstadions für sich entscheiden und die Jury mit einer unverwechselbaren Dachkonstruktion überzeugen.
Bauherr: Stadt Wien
Ort: AT-Wien
Architekten: querkraft architekten und skyline architekten, AT-Wien
querkraft.at
skyline-architekten.at
Fertigstellung: 2017
Fotos: Lukas Schaller/querkraft architekten
3. Preis
Historische Eisbahn in “Planten un Blomen”, DE-Hamburg | rimpf Architektur & Generalplanung, DE-Hamburg, Paul Schüler – Architekten, DE-Hamburg, plp Architekten Generalplaner, DE-Hamburg
Die historischen Kunsteisbahn wurde 1935 in der Hamburger Parkanlage „Planten un Blomen“ erbaut und zur internationalen Gartenschau 1973 in die Hamburger Wallanlage integriert. Den Entwurf zu Modernisierung und Erhalt lieferte die Arbeitsgemeinschaft aus rimpf Architektur & Generalplanung und Paul Schüler – Architekten und plp Architekten Generalplaner.
Bauherr: GMH | Gebäudemanagement Hamburg
Ort: DE-Hamburg
Architekten: rimpf Architektur & Generalplanung, DE-Hamburg, Paul Schüler – Architekten, DE-Hamburg und plp Architekten Generalplaner, DE-Hamburg
rimpf.de / org-architecture.com / plp-architekten.de
Fertigstellung: 2017
Fotos: Hagen Stier
Auszeichnung
Termalija Family Wellness, SI-Pod?etrtek | ENOTA, SI-Ljubljana
Mit diesem Projekt schließt das slowenische Architekturbüro ENOTA nach nunmehr fünfzehn Jahren die vollständige Umgestaltung der Therme Olimia ab.
Bauherr: Terme Olimia
Ort: SLO-Podcetrtek
Architekten: ENOTA, SLO-Ljubljana
enota.si
Fertigstellung: 2018
Fotos: Miran Kambic
Auszeichnung
Patscherkofelbahn, AT-Innsbruck | Innauer Matt Architekten mit Projektpartner ao-architekten, AT-Bezau/Innsbruck
Die Patscherkofelbahn führt vom Innsbrucker Stadtteil Igls auf den Patscherkofel. Sie wurde 1928 als Pendelbahn erbaut und 2017 durch eine Einseilumlaufbahn mit leicht veränderter Streckenführung nach einem Entwurf von Innauer Matt Architekten mit ihrem Projektpartner ao-architekten ersetzt.
Bauherr: Patscherkofelbahn GmbH | Stadt Innsbruck
Ort: AT-Innsbruck – Igls, Tirol
Architekten: Innauer-Matt Architekten ZT GmbH, AT-Bezau mit Projektpartner ao-architekten, AT-Innsbruck
www.innauer-matt.com
www.ao-architekten.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Adolf Bereuter
1. Preis
Amos Rex, FI-Helsinki | JKMM Architects, FI-Helsinki
Das Kunstmuseum Amos Rex des finnischen Architekturbüros JKMM Architects befindet sich im Herzen der Stadt Helsinki. Mit dem neuen Museumsbau findet zeitgenössische Architektur Einzug an einem prestigeträchtigen Ort mit historisch wertvoller Architektur.
Bauherr: Föreningen Konstsamfundet
Ort: FI-Helsinki
Architekten: JKMM Architects, FI-Helsinki
jkmm.fi
Fertigstellung: 2018
Fotos: Mika Huisman
2. Preis
LocHal Public Library, NL-Tilburg | Civic Architects, NL-Amsterdam, Academy of Architecture Tilburg, NL-Tilburg Braaksma & Roos Architecten, NL-Den Haag Inside Outside, NL-Amsterdam Mecanoo Architecten, NL-Delft
Gemeinsam haben die niederländischen Büros CIVIC Architects, Braaksma & Roos Architecten, Inside Outside/Petra Blaisse, Mecanoo Architecten sowie die Academy of Architecture Tilburg einen ehemaliger Lokomotivhangar aus dem Jahr 1932 in die öffentliche Bibliothek LocHal verwandelt.
Bauherr: Municipality of Tilburg
Ort: NL-Tilburg
Architekten: Civic Architects (NL-Amsterdam), Braaksma & Roos Architecten (NL-Den Haag), Inside Outside / Petra Blaisse (NL-Amsterdam), Mecanoo Architecten (NL-Delft) + Academy of Architecture Tilburg (NL-Tilburg)
Fertigstellung: 2018
Fotos: Stijn Bollaert
3. Preis
Forum, NL-Groningen | NL Architects, NL-Amsterdam, deMunnik-deJong-Steinhauser architectencollectief, NL-Amsterdam, NorthernLight, NL-Amsterdam TANK, NL-Amsterdam &Prast&Hooft, NL-Amsterdam
Mit dem Forum Groningen entwickelten NL Architects ein multifunktionales Gebäude – ein mit Büchern und Bildern gefülltes kulturelles „Kaufhaus“, das Ausstellungsräume, Kinosäle, Versammlungsräume und Restaurants bietet.
Bauherr: Stadt Groningen
Ort: NL-Groningen
Architekten: NL Architects, NL-Amsterdam
nlarchitects.nl
Fertigstellung: 2019
Fotos: Marcel van Derburg
Auszeichnung
Evang.-Luth. Gemeindezentrum, DE-Kösching | Diezinger Architekten, DE-Eichstätt
Das neue Gemeindezentrum definiert mit seiner kompakten, ausdrucksstarken Hoftypologie einen neuen Ort auf einer kleinen Anhöhe am Ortsrand von Kösching. Kirche, Gemeindezentrum und Turm gruppieren sich um einen gemeinsamen Innenhof.
Bauherr: Evang. – Luth. Gesamtkirchengemeinde Ingolstadt
Ort: DE-Kösching
Architekten: Diezinger Architekten, DE-Eichstätt
www.diezingerarchitekten.de
Fertigstellung: 2018
Fotos: Peter Bonfig
Auszeichnung
Stapferhaus, CH-Lenzburg | pool Architekten, CH-Zürich
Mit dem neuen Standort am Bahnhof Lenzburg erhält das Stapferhaus mit dem Entwurf des Zürcher Büro pool Architekten eine adäquate räumliche Präsenz, sowohl für seine inhaltlichen Werte wie auch für seine nationale, kulturelle Bedeutung.
Bauherr: Stiftung Stapferhaus
Ort: CH-Lenzburg
Architekten: pool Architekten, CH-Zürich
poolarch.ch
Fertigstellung: 2018
Fotos: Ralph Feiner
Auszeichnung
Harvard ArtLab, US-Allston, MA | B-L Barkow Leibinger, DE-Berlin
Das ArtLab entstand nach Plänen von Barkow Leibinger für die Harvard University an der North Harvard Street im Allston Campus. Der Bildungsbau trägt zur Aktivierung des Universitätsgeländes bei und schafft dringend benötigten Raum für die Vielfalt der auf dem Campus vertretenen künstlerischen Sparten.
Bauherr: Harvard University
Ort: USA-Allston
Architekten: Barkow Leibinger, DE-Berlin
www.barkowleibinger.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Iwan Baan, Amsterdam
1. Preis
FHNW-Campus, CH-Muttenz | pool Architekten, CH-Zürich
Inmitten der massiven Gewerbebauten am Muttenzer Gleisfeld bildet der kubische Baukörper der FHNW einen dominanten Abschluss. Ihm vorgelagert sind ein repräsentativer Platz und ein Park.
Bauherr: Hochbauamt Basel-Landschaft
Ort: CH-Muttenz
Architekten: pool Architekten, Zürich
www.poolarch.ch
Fertigstellung: 2018
Fotos: Andrea Helbling, Mark Niedermann
2. Preis
Architecture Faculty in Tournai, BE-Tournai | Aires Mateus e Associados, PT-Lisbon
Mitten im historischen Stadtzentrum der belgischen Stadt Tournai erweitern die portugiesischen Architekten Aires Mateus die Architekturfakultät der Stadt, die wiederum ein Ableger der Universität Louvain-la-Neuve (Neu-Löwen) ist.
Bauherr: Catholic University of Louvain
Ort: BE-Tournai
Architekten: Aires Mateus, PT-Lissabon
www.airesmateus.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Juan Rodriguez
3. Preis
Bildungscampus Friedrich Fexer, AT-Wien | querkraft architekten, AT-Wien Grundschule Freiham
Im Wiener Bildungsbauprogramm sieht das Konzept „Campus plus“ eine enge Verknüpfung zwischen Kindergarten und Schule vor, um den Übergang zwischen den Institutionen zu erleichtern. Vier Schulklassen und zwei Kindergartengruppen werden dabei zu Bildungsbereichen zusammengefasst und nutzen gemeinsame Multifunktionsflächen.
Bauherr: Stadt Wien
Ort: AT-Wien
Architekten: querkraft architekten und skyline architekten, AT-Wien
querkraft.at
skyline-architekten.at
Fertigstellung: 2017
Fotos: Lukas Schaller/querkraft architekten
Auszeichnung
Grundschule Freiham II Quartierszentrum, DE-München | wulf architekten, DE -Stuttgart
Grundlage für die Gestaltung der fünfzügigen Grundschule war für Wulf Architekten das „Münchner Lernhaus“: ein Haus zum Lernen für Kinder von 6 bis 10 Jahren und ein vielfältig bespielbarer Ort für den ganzen Tag.
Bauherr: Landeshauptstadt München, Baureferat Hochbau
Ort: DE-München-Aubing
Architekten: Wulf Architekten, Stuttgart
www.wulfarchitekten.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Brigida González
Auszeichnung
Schulcampus, AT-Neustift im Stubaital | fasch&fuchs.architekten, AT-Wien
Als komplexes Raumgefüge angelegt ist der Schulcampus Neustift geprägt von zwei markanten Kopfbauten: einem langen, schmalen, zweigeschossigen Bau direkt an Hauptstraße und einem fünfgeschossigen Kubus.
Bauherr: Gemeinde Neustift
Ort: AT-Neustift im Stubaital
Architekten: fasch&fuchs.architekten, AT-Wien
www.faschundfuchs.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Hertha Hurnaus
Auszeichnung
Null-Energie-Schule: Schubart Gymnasium, DE-Aalen | LIEBEL/ARCHITEKTEN, DE-Aalen, Transsolar Energietechnik, DE-Stuttgart
Der Fachklassentrakt für Biologie und Chemie wurde von Liebel/Architekten als Null-Energie-Gebäude konzipiert. Das integrale Klimakonzept minimiert den Technikeinsatz und nutzt die natürlichen Größen Licht, Thermik und Erdwärme maximal aus.
Bauherr: Stadt Aalen
Ort: DE-Aalen
Architekten: Liebel/Architekten BDA, DE-Aalen, transsolar, DE-Stuttgart
www.liebelarchitekten.de
www.transsolar.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Liebel/Architekten
Auszeichnung
Lernlandschaft, CH-Basel | ZMIK / Studio for Spacial Design, CH-Basel
Neue Unterrichtsformen fordern neue Raumstrukturen und Mitsprache. In der Primarschule St. Johann gestaltete ZMIK die drei Hauptkorridore zu vielfältigen Lern- und Aufenthaltsorten um.
Bauherr: Erziehungsdepartement Basel
Ort: CH-Basel
Architekten: ZMIK // Studio for Spacial Design, CH-Basel
www.zmik.ch
Fertigstellung: 2019
Fotos: Weisswert, Basel
1. Preis
Grüne Erde Welt – Ein Gebäude das atmet, AT-Steinfelden | terrain: integral designs, DE-München
Grüne Erde hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten spezialisiert, die Nachhaltigkeit und fairem Handel gerecht werden. Auch bei ihrem neuen Flagshipstore mit Produktionsstandort im österreichischen Steinfelden ist der Produzent seinen Grundsätzen treu geblieben und hat inmitten von Wäldern, Wiesen und Bergen in einer dünn besiedelten Gegend ein Gebäude aus natürlichen Baustoffen errichtetet, das das natürliche Umfeld einbezieht und mit geringem ökologischen Fußabdruck auskommt.
Bauherr: Gruene Erde GmbH, Scharnstein
Ort: AT-Steinfelden
Architekten: terrain: integral designs, ARKADE ZT, transsolar
www.terrain.eco / www.arkd.at / www.transsolar.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Jan Schuenke
2. Preis
Parking Building IMEC / KUL, BE-Leuven | STÉPHANE BEEL ARCHITECTS, BE-Gent
Auf dem Campus Arenberg III wurde ein neues Parkhaus nach dem Entwurf des belgischen Büros Stéphane Beel Architects errichtet. Das Parkhaus wurde parallel zur Straße Kapeldreef angelegt und fungiert auf dem Campus als Vermittler zweier Standorte.
Bauherr: IMEC and KU Leuven
Ort: BE-Leufen
Architekten: Stéphane Beel Architects
www.stephanebeel.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: Luca Beel
3. Preis
Muttenz Water Purification Plant, CH-Muttenz | Oppenheim Architecture, CH-Muttenz Basel
Die von Oppenheim Architecture Europa im schweizerischen Muttenz geplante Kläranlage ist ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit, das äußerst sensibel mit der kontrastreichen Umgebung am Rheinufer umgeht.
Bauherr: Stadt Muttenz
Ort: CH-Muttenz
Architekten: Oppenheim Architecture
www.oppenoffice.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Aaron Kohler, Rasem Kamal, Börje Müller
Auszeichnung
Pacherhof neuer Keller, IT-Neustift- Vahrn | Bergmeisterwolf Architekten, IT-Brixen
Wichtiges Zeugnis für die Winzertradition des Weinguts in Eisacktal bei Brixen ist der denkmalgeschützte Hof aus dem 11. Jahrhundert, der fortwährend erweitert wurde. bergmeisterwolf architekten schufen neue Kellerräume für den historischen Säulenkeller von 1450.
Bauherr: Familie Huber – Pacherhof
Ort: IT-Neustift-Vahrn
Architekten: Bergmeisterwolf, Brixen
www.bergmeisterwolf.it
Fertigstellung: 2018
Fotos: Gustav Willeit
1. Preis
Casa Desordenada, ES-Granada | SERRANO+BAQUERO Arquitectos, ES-Granada
Mit dem Wohnhaus Casa Desordenada in Granada hat das spanische Architekturbüro Serrano+Baquero ein „Haus im Haus“ entworfen, bei dem bereits vorhandene Strukturen mit neu hinzugefügten Elementen kombiniert wurden.
Bauherr: CUGSA
Ort: ES-Granada
Architekten: Serrano+Baquero, ES-Granada
www.sarranoybaquero.com
Fertigstellung: 2017
Fotos: Serrano+Baquero
2. Preis
Musterzimmer im Landlab Schloss Wiehe, DE-Roßleben-Wiehe | Studierende der Architektur, FH Erfurt / Professoren Bechthold/Kaindl/Deckert, LB Bigeschke, DE-Erfurt
Für das leerstehende Schloss Wiehe im nördlichen Thüringen entwickelten Studierende der Fachhochschule Erfurt im Studiengang Architektur ein Gesamtkonzept für die Umnutzung des Bestands zum Tagungs- und Klausurhau.
Bauherr: Stadt Roßleben-Wiehe
Ort: DE-Roßleben-Wiehe
Architekten: Studierende der Architektur,
FH Erfurt Professoren Bechthold/Kaindl/Deckert, LB Bigeschke
www.fh-erfurt.de
Fertigstellung: 2019
Fotos: Fachhochschule Erfurt
3. Preis
Bos en Duin A // 19, NL-Oostkapelle | Aretz Dürr Architektur, DE-Köln
Für ein Ferienhaus im niederländischen Küstenort Oostkapelle gestalteten Aretz Dürr Architektur aus Köln ein Gartenhaus zum Verstauen von Fahrrädern und Gartengeräten. Vorgaben waren ein natürlicher Baustoff wie Holz, der ohne Pflege auskommt. Gleichzeitig sollte die ohnehin schon kleine Gartenfläche nicht noch weiter minimiert werden. Der Kostenrahmen orientierte sich an einem Fertigbausatz aus dem Baumarkt.
Bauherr: Privat
Ort: NL-Oostkapelle
Architekten: Aretz Dürr Architektur, DE-Köln
aretzduerr.de
Fertigstellung: 2019
Fotos: Sven Aretz / Sophie Schulten
Auszeichnung
Das schwarze Haus, DE-Breitbrunn a. Ammersee | BUERO WAGNER, DE-Herrsching
Das Schwarze Haus errichteten die ortsansässigen Architekten von Buero Wagner am Ammersee ohne jegliche chemische Behandlung der Oberflächen. Die Holzverkleidung der Fassaden ist durch ein präventives Verkohlungsverfahren wasserabweisend und resistent gegen Pilze. Die Innenwände, Böden und Decken aus Stahlbeton mit einer eingegossenen Flächenheizung sind roh belassen und lediglich sandgestrahlt oder geschliffen, um die Textur der Gesteinszuschläge hervorzuheben.
Bauherr: Privat
Ort: DE-Breitbrunn am Ammersee
Architekten: Buero Wagner, DE-Herrsching
buerowagner.eu
Fertigstellung: 2018
Fotos: Buero Wagner
Auszeichnung
Housing and Nursery, CH-Auvernier | frundgallina, CH-Neuchâtel
In der Nähe des historischen Zentrums des Dorfs Auvernier im Kanton Neuenbug hat das Schweizer Architekturbüro frundgallina einen charakteristischen Neubau entworfen.
Bauherr: Municipality of Milvignes
Ort: CH-Auvernier
Architekten: frundgallina, CH-Neuchâtel
www.frundgallina.ch
Fertigstellung: 2017
Fotos: J-C Frund
Auszeichnung
Haus in Altschönau, DE-Altschönau | Maximilian Hartinger Architekt, DE-München
Die Bauherrschaft, eine junge Familie aus dem Bayerischen Wald, wünschte sich ein günstiges Haus mit der Anmutung eines typischen lokalen „Stadels“ (Scheune) und einer Orientierung zum panoramaartigen Ausblick.
Bauherr: Privat
Ort: DE-Altschönau
Architekten: Maximilian Hartinger, DE-München
www.maxhartinger.de
Fertigstellung: 2018
Fotos: Sebastian Schels
1. Preis
Terrassenhaus Berlin / Lobe Block, DE- Berlin | Brandlhuber+ Emde, Burlon / Muck Petzet Architekten, DE-Berlin/München
Mit dem Terrassenhaus Berlin / Lobe Block im Berliner Ortsteil Wedding haben Brandlhuber+ Emde, Burlon / Muck Petzet Architekten ein Update der Typologie des Terrassenhauses vorgenommen: Den Verlust an öffentlichem Raum, der mit der großflächigen Überbauung des Grundstücks einherging, glichen sie mit weiträumigen, halböffentlichen Terrassen aus.
Bauherr: Lobe Block / Olivia Reynolds & Elke Falat
Ort: DE-Berlin
Architekten: Brandlhuber+ Emde, Burlon/Muck Petzet Architekten, DE-Berlin
brandlhuber.com
muck-petzet.com
Fertigstellung: 2018
Fotos: David von Becker, Erika Overmeer
2. Preis
Anandaloy, BD-Rudrapur | Studio Anna Heringer, DE-Laufen
Oftmals wird in Bangladesch eine Behinderung als Strafe Gottes oder als schlechtes Karma angesehen, was zur Folge hat, dass die Gehandicapten entsprechend isoliert leben müssen. Therapieplätze sind rar gesät und in ländlichen Gebieten wie Rudrapur gänzlich unbekannt. Im Anandaloy Gebäude wurde ein Zentrum für Menschen mit Behinderung mit einem Textil-Workshop kombiniert.
Bauherr: Dipshika
Ort: BGD-Rudrapur
Architekten: Studio Anna Heringer, DE-Laufen
anna-heringer.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: Studio Anna Heringer, Stefano Mori
3. Preis
Frische Schale – Reifer Kern, CH-Teufen | Barbara Gschwend Architektur.Innenarchitektur, CH-Nänikon
Motiviert vom Potential des Bestands interpretierte die Architektin Barbara Gschwend die vorhandene Struktur des traditionellen Appenzeller Bauernhauses in Form einer modernen Holzbaukonstruktion neu.
Bauherr: Privat
Ort: CH-Teufen
Architekten: Barbara Gschwend Architektur
barbaragschwend.ch
Fertigstellung: 2018
Fotos: Alex Filz
Auszeichnung
Spreestudios, DE-Berlin | Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten, DE-Berlin
Auf dem östlichen „Baufeld A“ der Berliner Spreestudios realisierten Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten durch die Aufstockung der ehemaligen Garagen und Werkhallen der DDR-Zollverwaltung stark differenzierte und individualisierbare Gewerbeeinheiten von 50 bis 650 Quadratmetern.
Bauherr: Spreestudios GmbH & Co. KG
Ort: DE-Berlin
Architekten: Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten, DE-Berlin
tbbk.de
Fertigstellung: 2018
Fotos: Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten / Filip Kujawski
Auszeichnung
Studio Cascina Garbald, CH-Castasegna | Ruinelli Associati Architetti, CH-Soglio
Die Cascina befindet sich auf der Wiese hinter dem Gebäudekomplex Villa Garbald. Das Haus ist ein Wiederaufbau in der gleichen Position, dem gleichen Volumen und der gleichen Höhe des vorherig bestehenden Gebäudes (ehemaliges Kastaniendörrhaus). Dies nicht nur, weil es von der Bauordnung vorgeschrieben ist, sondern weil be- wusst ein behutsamer Zugang zum Thema und zur Landschaft gesucht wurde.
Bauherr: Fondazione Garbald
Ort: CH-Castasegna
Architekten: Ruinelli Associati Architetti, Soglio
ruinelli-associati.ch
Fertigstellung: 2019
Fotos: Raymond Meier, Marcello Mariana, Ralph Feiner
Auszeichnung
Architekturcluster Stadtelefant, AT-Wien | Franz&Sue, AT-Wien
Als gewerbliche Baugruppe haben die Architekturbüros Franz & Sue, PLOV und Solid gemeinsam mit den branchennahen Unternehmen A-NULL Bausoftware und Hoyer Brandschutz dieses Quartiershaus errichtet.
Bauherr: Bloch-Bauer-Promenade 23 Real GmbH
Ort: AT-Wien
Architekten: Franz & Sue, PLOV und Solid
franzundsue.at
Fertigstellung: 2019
Fotos: David Schreyer
1. Preis
Genossenschaftshaus Stadterle, CH -Basel | Buchner Bründler Architekten, CH-Basel
Ehemals ein Güterbahnhof, wurde der östliche Teil des Gebiets als Erlenmatt Ost zum Wohnquartier weiterentwickelt, das mit mehreren Bauten an einen Park angrenzt. Initiiert wurde das Projekt von der Stiftung Habitat. Der Planungs- und Bauprozess wurde partizipativ mit den Genossenschaftlern gestaltet.
Bauherr: Wohngenossenschaft Zimmerfrei, Basel
Ort: CH-Basel
Architekten: Buchner Bründler Architekten
www.bbarc.ch
Fertigstellung: 2017
Fotos: Daisuke Hirabayashi, Basile Bornand
2. Preis
Hebammenhaus, GH-Havé Etoe (Volta Region) | Peter Behrens School of Arts Fachbereich / Hochschule Düsseldorf, DE-Düsseldorf, Georgia Institute of Technology, US-Atlanta, imagine structure, DE-Köln / Frankfurt am Main, Hochschule Koblenz, Havé Tech Berufsschule Ghana, transsolar, DE-München
Etwa 50 Studierende haben gemeinsam mit deutschen Handwerksauszubildenden und Ghanaischen Berufsschülern ein Hebammenwohnheim entworfen und gebaut. Fertiggestellt wurde das Projekt 2018. Das Dorf Havé Etoe liegt mitten im Dschungel im bergigen Teil an der Grenze zu Togo.
Bauherr: Meeting Bismarck Gododo Ghana Geburts und Kinderhilfe e.V.
Ort: GH-Havé Etoe (Volta Region)
Architekten: Peter Behrens School of Arts Fachbereich / Hochschule Düsseldorf, DE-Düsseldorf, Georgia Institute of Technology, US-Atlanta, imagine structure, DE-Köln/ Frankfurt, Hochschule Koblenz, DE-Koblenz, Havé Tech Berufsschule, Ghana, Transsolar Klimaengineering
Fertigstellung: 2018
Fotos: David Kwaku Photography / Thomas Schaplik
3. Preis
`t Atelier, BE-Mechelen | dmvA architecten, BE-Mechelen
Mit dem gemeinnützigen ‘t Atelier im belgischen Mechelen realisierte das belgische Architekturbüro dmvA architecten in enger Zusammenarbeit mit dem Bauherrn ein besonderes Projekt, das zu großen Teilen in der hauseigenen Tischlerwerkstatt ausgeführt werden konnte.
Bauherr: vzw ‘t Atelier
Ort: BE-Mechelen
Architekten: dmvA architecten, BE-Mechelen
www.dmva-architecten.be
Fertigstellung: 2019
Fotos: Johnny Umans
Auszeichnung
New Correctional Facility, GL-Nuuk | Schmidt Hammer Lassen Architects, DK-Copenhagen, FRIIS & MOLTKE Architects, DK-Aarhus
Eingebettet in die zerklüftete Landschaft von Grönlands Küstenhauptstadt Nuuk ist nach einem Entwurf des Kopenhagener Architekturbüro Schmidt Hammer Lassen Architects gemeinsam FRIIS & MOLTKE Architects aus Aarhus eine neue Justizvollzugsanstalt, die Ny Anstalt, entstanden.
Bauherr: Danish Ministry of Justice/ Danish Prison and Probation Service
Ort: GL-Nuuk
Architekten: Schmidt Hammer Lassen Architects, DK-Copenhagen mit FRIIS & MOLTKE Architects, DK-Aarhus
www.shl.dk / www.friis-moltke.com
Fertigstellung: 2019
Fotos: : Schmidt Hammer Lassen Architects
Auszeichnung
Betonoase, DE-Berlin | GRUBER + POPP ARCHITEKTEN, DE-Berlin
Inmitten von zehn-bis zwanziggeschossigen Wohnhochhäusern im Berliner Stadtteil Lichtenberg hat das Büro GRUBER + POPP ARCHITEKTEN einen Pavillon mit dem wundersamen Namen „Betonoase“ errichtet.
Bauherr: Bezirksamt Lichtenberg, Abt. Facility Management
Ort: DE-Berlin
Architekten: GRUBER + POPP ARCHITEKTEN BDA, DE-Berlin
www.gruberpopp.de
Fertigstellung: 2018
Fotos: Alexander Blumhoff