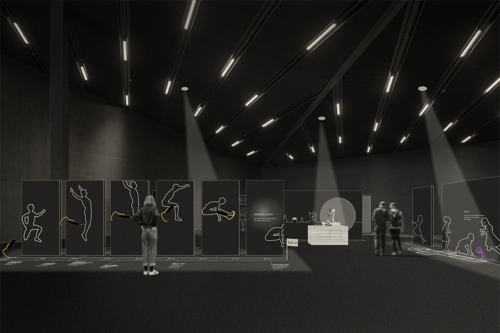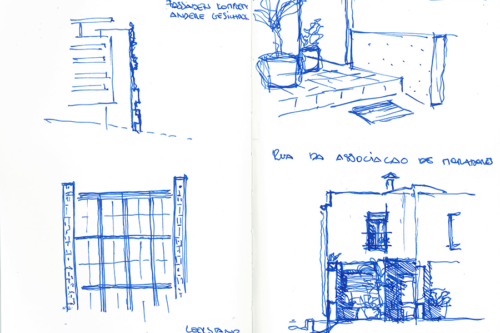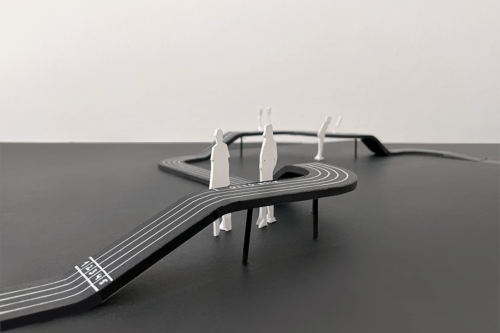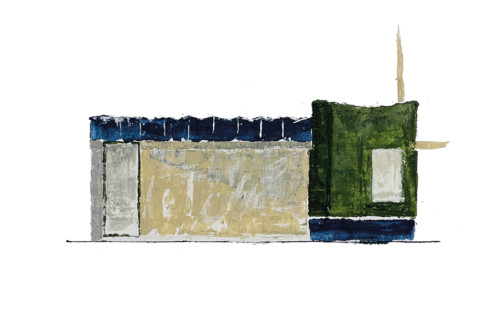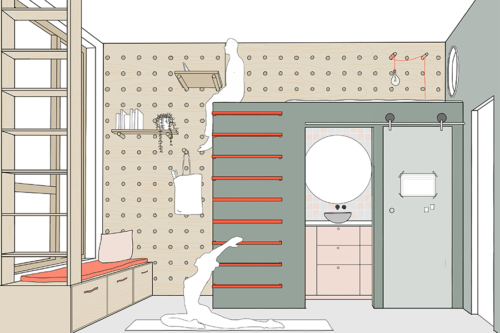Unsere Interviewserie heißt „Upcoming Architects Facing New Conditions“. Was sind die „New Conditions“ in Ihrer Arbeit?
Die „New Conditions“, der Klima-Notstand, sind gar nicht wahnsinnig neu. Wir beschäftigen uns schon seit längerem mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich denke, unsere Projekte gehen ökologisch schon in eine gute Richtung. In Österreich haben wir uns das politische Ziel gesetzt, 2040 klimaneutral zu sein. Wenn wir das ernst meinen, müssen wir in acht Jahren bei minus 55 Prozent CO2 in allen Branchen sein. Das ist komplett crazy, aber auch nötig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. In den Neunzigerjahren hat man das bereits geahnt, aber das tatsächliche Ausmaß war noch nicht so klar als heute. Bis die Tatsachen aber mit all ihren Konsequenzen im Oberstübchen angekommen sind, dauert es wohl noch. Natürlich, die Gesellschaft hat sich bereits in die richtige Richtung aufgemacht, aber das erforderliche Ausmaß ist noch lang nicht erreicht.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen wurde von einem Ihrer Bauherren als unbürokratisch bezeichnet. Wie schaffen Sie es bei einem Bündel von Normen, Richtlinien und Gesetzesvorgaben unbürokratisch zu arbeiten?
Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich unbürokratisch sind. Wahrscheinlich sind wir unbürokratischer als manch anderer. Wir machen uns bewusst, dass Gesetze, Normen und technische Richtlinien, nicht die ganze Realität sind, sondern dass sie lediglich Modelle sind, die wir als Gesellschaften bewusst oder unbewusst gewählt haben. Natürlich muss man sich an das allermeiste halten, aber man sollte trotzdem nichts unhinterfragt, sklavisch annehmen. Wir arbeiten ja primär im Wohnbau und ich glaube, wenn wir partizipativ arbeiten und die wirklichen Bedürfnisse von Menschen versuchen zu verstehen, dann gibt es Grundlegenderes, als Normen einzuhalten.
Was sind heute die „wirklichen“ Bedürfnisse der Gesellschaft im Wohnungsbau?
Uns geht es darum in partizipativen Workshops die wahrhaftigen Bedürfnisse der Nutzer*innen zu ermitteln. Aktuell haben wir unser zwölftes partizipatives Projekt am Laufen. Das heißt, wir haben schon relativ viel Erfahrung mit dem Thema. Diese Workshopgruppen bestehen meistens aus dreißig bis sechzig Erwachsenen. Das heißt im Laufe der letzten zwölf Jahre hatte ich mit hunderten von Menschen zu tun und da ist es wichtig, dass man genau zu hört. Dabei heißt Partizipation nicht, jeder spricht bei jedem Strich in der Planungszeichung mit, sondern dass wir die Nutzer*innen als Expert*innen für ihre Bedürfnisse anerkennen und wir diese in Architektur übersetzen. Wir stellen fest, dass sich die grundlegenden Bedürfnisse tatsächlich nicht stark verändert haben. Dabei würde ich grundsätzlich zwischen dem individuellen Wohnraum und dem, was vor der Wohnungstür im direkten Wohnumfeld stattfindet, unterscheiden. Normale Bedürfnisse innerhalb einer Wohnung sind noch immer total konservativ. Die Wohnung soll immer einen funktionierenden Grundriss haben, wo Möbel gescheit untergebracht werden können, ein gewisser Schallschutz wirkt, ausreichend Licht vorhanden ist und Freiraum zur eigenen Entfaltung bleibt. Ein bisschen komplexer wird es in der Regel bei den Bedürfnissen außerhalb der Wohnungstür, mit denen wir uns bei unserer Arbeit ausführlich befassen.
Was für Bedürfnisse sind das konkret? Sie sind Mitbegründer und auch Mitbewohner des Vereins „Wohnprojekt Wien“. Erzählen Sie uns davon.
Ja, genau. Das Projekt umfasst 39 Wohnungen, dort geht es über die eigene Wohnung hinaus viel um Bedürfnisse des einzelnen und der Gemeinschaft an sich. Denn ich möchte in allen Räume Aufenthaltsqualität haben. Ich möchte, dass wenn meine Kinder die Wohnung verlassen auch im Gang noch Raum für sie ist und sie das ganze Haus als ihren Lebensraum begreifen können. Ich möchte, dass wenn ich jemand im Stiegenhaus treffe, gerne stehen bleiben und Platz haben kann, um mich zu unterhalten. Und ich möchte vernünftige Mobilitätsangebote haben, sodass ich kein Auto besitzen muss, dafür aber ein Lastenfahrrad nutzen kann. Ich möchte, wenn ich Werkzeug brauche, nicht jeden Hammer, nicht jede Bohrmaschine selber kaufen müssen. Und ich möchte Räume im Haus haben, wo wir Kindergeburtstagspartys feiern, Veranstaltungen ausrichten, gemeinschaftlich kochen und Freunde einladen können. Ich könnte noch lange so weitermachen.
Ich glaube, es gibt ganz viele Bedürfnisse, die wir außerhalb unserer Wohnungstür befriedigen können. Dabei geht es nicht nur um Komfort und Bequemlichkeit, sondern es geht darum, positiv in die Gesellschaft zu wirken, über Veranstaltungen, über Solidaritäts-Flohmärkte und über die Aufnahme von Geflüchteten. Denn ich möchte mich als Gruppe auch solidarisch erklären können. Wir haben beispielsweise 2015 Geflüchtete aufgenommen, die mittlerweile seit sieben Jahren bei uns mit im Haus wohnen.
Sie leben seit acht Jahren in diesem Projekt. Würden Sie heute Dinge korrigieren, wenn Sie könnten?
Wir sind in einem Verein organisiert, uns gehört dieses Haus gemeinschaftlich. Ich habe also kein Verkaufs-oder Weitergabe-Recht für meine individuelle Wohnung, aber natürlich ein Nutzungsrecht. Außerdem kostet einen das Ganze viel Zeit, Herzblut und Arbeit. Das Haus muss geputzt und der Garten gepflegt werden. Wenn man ein Einfamilienhaus hat, kennt man das, aber als Stadtbewohner mit einer normalen Mietwohnung ist das eher fremd. Was ich aber sagen würde: Ich kann mir kein anderes Lebensmodell mehr vorstellen, weil es so viele Bedürfnisse von mir und meiner Familie befriedigt, die in einer noch so schönen Wohnung irgendwo anders nicht befriedigbar wären.
Erachten Sie ein Baugruppen-Projekt als eine Art Garant für nachhaltiges, funktionierendes Wohnen?
Absolut. Das Ganze hat natürlich ein paar Fallstricke: Man muss sich stark damit beschäftigen, wie diese Gruppe von Menschen organisiert werden kann, wie kommuniziert wird und wie Entscheidungen getroffen werden. Das hat eine stark kulturelle Komponente. Für mich ist diese Form der Bauherrenschaft ein extrem gutes Beispiel für eine sozial ausgerichtete Architektur. Es ist kein Zufall, dass sich in Österreich die allermeisten dieser Projekte, nicht nur um das Wohl der eigenen Bewohner*innen kümmern, sondern sich, in einem gewissen Maßstab, auch solidarisch mit Menschen zeigen, die es weniger guthaben. Wir haben zum Beispiel genau zu diesem Zweck zwei Solidaritätswohnungen im Haus. In meiner Vorstellung sollte so Gesellschaft funktionieren. Eine Gesellschaft mit überschaubaren Gemeinschaftseinheiten, wo Menschen sich kennen, gemeinsame Ziele verfolgen und gemeinsam Verantwortung tragen. Wir hundert Menschen in unserer Hausgemeinschaft können, glaube ich, jetzt nicht Verantwortung für fünfzig Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder mit Fluchthintergrund übernehmen, aber für sechs bis neun Menschen ist das kein Problem. Ich finde, wir haben da ein wirklich großartiges sozial-verantwortliches Modell.
Was sind für Sie die absolut wesentlichen Kriterien für einen nachhaltigen Wohnungsbau?
Ein Kriterium ist für mich (und das kann nicht jedes Haus im gleichen Maße erfüllen), dass ein Wohnhaus nicht ausschließlich individuelle Räume bietet. Es geht mir da um Bedürfnisse, die ich nur außerhalb meiner Wohnungstür befriedigen kann. Das beginnt bei einer vernünftigen primären Struktur, die langfristig angelegt ist und über Generationen hinweg Umgestaltung und Umnutzung zulässt. In Wirklichkeit bauen wir, was unsere Grundrisse angeht, relativ einfache Häuser. Wir haben meistens sehr einfache Systeme, die Flexibilität und Partizipation in den Fokus stellen.
Ich würde immer sagen, die Grundstruktur der Häuser muss auf Generationen angelegt sein. Auf materieller und ökologischer Ebene ist der Energiebedarf zentral. Wir haben viel zu lange nur die Energieverbräuche der Häuser selbst betrachtet, wenn wir bauen reicht der Verbrauch und die CO2-Emission aber viel weiter. Im Grunde beginnt die Energie- und CO2-Bilanz bereits beim Verkehrsaufwand mittels LKW und Co. bei der Entstehung des Bauprojektes. Wir müssen die Prozesse hier viel mehr hinterfragen.
Wir haben einen Mangel an Wohnungen in allen größeren Städten Europas. Ein Großteil des Problems könnte gelöst werden, indem der Leerstand für Wohnzwecke wieder verfügbar gemacht werden würde. Müsste sich der Staat hier Ihrer Meinung nach mehr einmischen?
Natürlich, der Staat muss sich auf vielen Ebenen mehr einmischen. Gerade dieses spezifische Thema, wie wir mit Wohnungsleerstand umgehen und wie dieser verfügbar und zugänglich gemacht werden kann, ist eines der komplexesten Themen überhaupt. Hinzukommt, dass viel zu viele Menschen auf zu vielen Quadratmetern leben. Diese zwei Phänomene in Kombination, sind politisch unfassbar schwer zu adressieren oder gar strategisch schnell zu lösen, denn ich greife mit diesem Thema in Eigentumsrechte ein. Dafür wird es einen Paradigmenwechsel brauchen. Die Schweizer sind da teilweise ziemlich radikal. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber in Vorbildprojekten in Zürich gibt es beispielsweise klare Belegungsregeln. Wenn eine dreiköpfige Familie in einer Vierzimmerwohnung lebt und das Kind auszieht, dann haben die Eltern hier zum Beispiel maximal ein Jahr Zeit bis sie selbst ausziehen müssen. Das sind schon harte und sehr persönliche Eingriffe. In Österreich ist sowas noch nicht vorstellbar und in Deutschland habe ich auch noch nichts von derartigen Projekten gehört.
In vielen Großstädten entstehen derzeit hunderte von neuen Quartieren, die den Charakter eines nutzungsdurchmischten Dorfes oder Kleinstadt haben werden. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Es gibt viele Quartiere, die so etwas anstreben; manche schaffen es besser und manche schlechter. Es geht darum, in Neubaugebieten von vornherein eine gute Nutzungsmischung hinzubekommen. Wir arbeiten selber an einem Projekt, was gerade im Bau ist, wo eine ziemlich radikale Nutzungsmischung von fünfzig Prozent Wohnen und fünfzig Prozent Arbeiten entsteht. Dort werden innerhalb eines Gebäudes etwa zweihundert Menschen arbeiten und hundert Menschen wohnen, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, mit all den technischen, rechtlichen, brandschutzmäßigen Vorgaben, die es zu realisieren gilt. Das ist alles andere als trivial. Würden die Nutzungseinheiten als zwei Gebäude nebeneinanderstehen, wäre es wesentlich einfacher. Die Idee der funktionalen Trennung (also der Trennung von Wohnen, Arbeiten und Verkehr), die aus der klassischen Moderne kommt, ist ja nicht mal hundert Jahre alt und kein Erfolg. Davor war eine Nutzungsmischung oft Standard. Es war insofern klar, dass wir wieder zu gemischten Quartieren zurückkommen müssen.
Wir sind konfrontiert mit Klimawandel, Ressourcenengpässen und womöglich weiteren Pandemien. Welche Auswirkungen wird das auf unsere Baukultur haben?
Im Bezug auf Ressourcenknappheit, Lieferengpässe und Klimawandel ist relativ offensichtlich, welche Auswirkungen das haben wird. Von der EU gibt es da ja mittlerweile sehr klare Ansagen zu. Wir werden uns im Neubaubereich mit der Demontierbarkeit, Verwertbarkeit, Materialerfassung auf allen Ebenen beschäftigen und Rückbaukonzepte mitdenken müssen.
Kreislaufwirtschaft generell und die Verwendung von Sekundärbaustoffen werden immer wichtigere Themen, denn wenn wir nicht mehr alles jederzeit neu verfügbar haben, müssen wir einfach mehr Hirnschmalz in die Prozesse stecken, um wiederverwenden zu können, was bereits vorhanden ist.